 Der Dachverband fordert ein Konzept zur Einführung in die richterliche Tätigkeit, welches den Besonderheiten des Tätigkeitsbereichs eines Verwaltungsrichters Rechnung trägt und unter Einbindung der richterlichen Standesvertretungen entwickelt wird.
Der Dachverband fordert ein Konzept zur Einführung in die richterliche Tätigkeit, welches den Besonderheiten des Tätigkeitsbereichs eines Verwaltungsrichters Rechnung trägt und unter Einbindung der richterlichen Standesvertretungen entwickelt wird.
Die Wichtigkeit spezieller Schulung von Richterinnen und Richter vor Aufnahme ihrer Tätigkeit wird in den Ausbildungsgrundsätzen des Europäischen Netzwerks zur justiziellen Aus- und Fortbildung (EJTN) ausdrücklich betont. Ebenso betont wird die Notwendigkeit, die justizielle Ausbildung nicht auf juristische Kenntnisvermittlung zu beschränken, sondern auch berufliche Fertigkeiten und Werte weiterzugeben.
Verbindliche Besetzungsvorschläge – Präsidentenauswahl
Für die Richterauswahl selbst fordert der Dachverband die Verbindlichkeit der Besetzungsvorschläge der Personalsenate (Personalausschüsse), um so dem Vorwurf politisch motivierter Richterernennungen wirksam entgegentreten zu können.
Aus denselben Überlegungen wird auch gefordert, in den Organisationsgesetzen der Verwaltungsgerichte das Auswahlverfahren für Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten den Personalsenaten (Personalausschüssen) zu übertragen. Diese Forderung entspricht der Empfehlung des Europarates (CCJE) über die Funktion der Gerichtspräsidenten (Opinion N° 19 (2016). Nach diesen Empfehlungen sollte das Auswahlverfahren für Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten nach denselben Grundsätzen gestaltet werden, wie jenes für Richterinnen und Richter. Eine Auswahl von Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten (ausschließlich) aus dem Kreise der Richterschaft wäre aus Sicht des Dachverbandes auch im Hinblick auf die Gewaltenteilung wünschenswert.
Rechtsschutz für übergangene Bewerber
Dem Vorwurf politisch motivierter Richterernennungen kann nach Auffassung des Dachverbandes auch dadurch wirksam entgegen getreten werden, dass – nach verbindlichen Besetzungsvorschlägen – nicht berücksichtigten Bewerbern ein Rechtsschutz eingeräumt wird. Die Empfehlungen des Europarates aus dem Jahr 2010, R(2010)12, sehen dazu vor, dass Auswahl- und Karriereentscheidungen richterlicher Gremien transparent und nachvollziehbar zu begründen sind; nicht berücksichtigten Bewerbern soll die Möglichkeit offen stehen, die Auswahlentscheidung oder das Auswahlverfahren einer Überprüfung zu unterziehen.
Der Dachverband fordert daher, die Auswahlverfahren transparent und nachvollziehbar zu gestalten sowie die Ergebnisse analog zu § 10 Abs. 2 Ausschreibungsgesetz 1989 zu veröffentlichen. (Siehe dazu auch: Vereinheitlichung und Verrechtlichung der Auswahlverfahren notwendig)
Den Rest des Beitrags lesen »
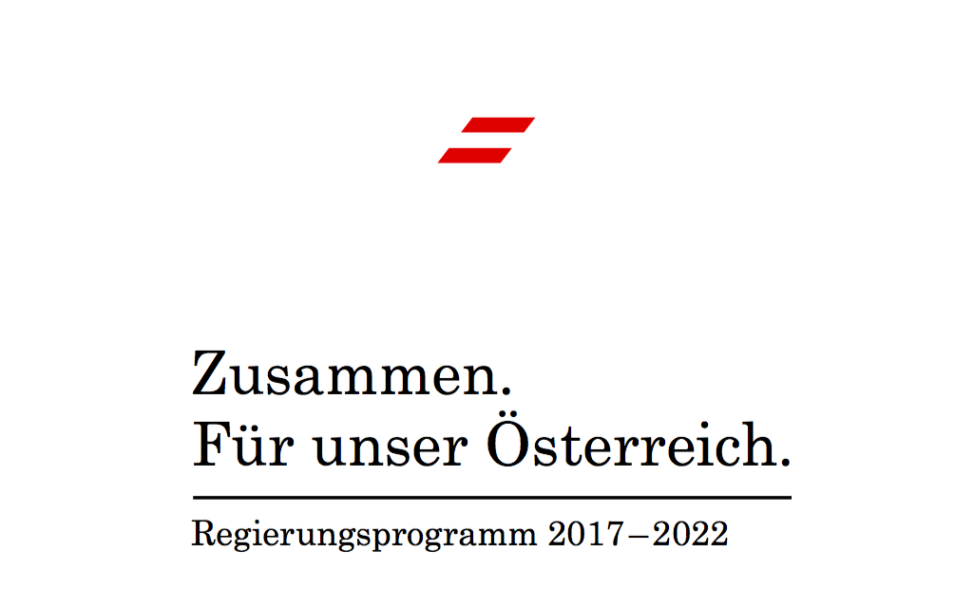 Unter den Kapiteln „Moderner Bundesstaat“, „Schlanker Staat“ oder „Moderner Verfassungsstaat“ enthält das Regierungsprogramm eine Reihe von Vorhaben, die Auswirkungen auf die künftige Verfahrensführung der Verwaltungsgerichte haben werden. Zahlreiche vorgeschlagene Änderungen sind deckungsgleich mit der „Agenda VG 2022“, dem Forderungspapier des Dachverbands der Verwaltungsrichter.
Unter den Kapiteln „Moderner Bundesstaat“, „Schlanker Staat“ oder „Moderner Verfassungsstaat“ enthält das Regierungsprogramm eine Reihe von Vorhaben, die Auswirkungen auf die künftige Verfahrensführung der Verwaltungsgerichte haben werden. Zahlreiche vorgeschlagene Änderungen sind deckungsgleich mit der „Agenda VG 2022“, dem Forderungspapier des Dachverbands der Verwaltungsrichter.
 Die Fachgruppe „Europarecht und internationale Richterzusammenarbeit“ der Richtervereinigung organisiert in der Zeit vom
Die Fachgruppe „Europarecht und internationale Richterzusammenarbeit“ der Richtervereinigung organisiert in der Zeit vom  Die Urteilsbegründung eines Grazer Richters sorgt für viel Unmut. Die Kritik daran von innen und außen ist mehr als berechtigt. Ein Gastkommentar von Oliver Scheiber.
Die Urteilsbegründung eines Grazer Richters sorgt für viel Unmut. Die Kritik daran von innen und außen ist mehr als berechtigt. Ein Gastkommentar von Oliver Scheiber. Der Dachverband der Verwaltungsrichter (DVVR) hat sich in seinem
Der Dachverband der Verwaltungsrichter (DVVR) hat sich in seinem