 Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich erstmals dazu geäußert, ob nationale Gerichte befugt oder sogar verpflichtet sind, gegen die Verantwortlichen nationaler Behörden eine Zwangshaft zu verhängen, wenn sich diese beharrlich weigern, gerichtlich auferlegte – und auf Unionsrecht fußende – Verpflichtungen zu erfüllen (Rechtssache C-752/18, Deutsche Umwelthilfe / Freistaat Bayern).
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich erstmals dazu geäußert, ob nationale Gerichte befugt oder sogar verpflichtet sind, gegen die Verantwortlichen nationaler Behörden eine Zwangshaft zu verhängen, wenn sich diese beharrlich weigern, gerichtlich auferlegte – und auf Unionsrecht fußende – Verpflichtungen zu erfüllen (Rechtssache C-752/18, Deutsche Umwelthilfe / Freistaat Bayern).
Fahrverbote nicht umgesetzt
Anlassfall war ein Rechtsstreit in Deutschland, bei dem sich Mitglieder von Landesregierungen in Bayern und Baden-Württemberg geweigert hatten, von Verwaltungsgerichten verfügte Fahrverbote für Dieselfahrzeuge umzusetzen. Zur Durchsetzung der Fahrverbote hatten Gerichte mehrfach Zwangsgelder verhängt, allerdings ohne Erfolg. Daher hatte die „Deutsche Umwelthilfe“ beim Verwaltungsgericht München beantragt, den bayerischen Umweltminister oder den Ministerpräsidenten in Zwangshaft zu nehmen.
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Dieser sollte klären sollte, ob ein deutsches Gericht berechtigt ist, eine solche Zwangshaft zu vollstrecken.
EuGH legt Prüfungsmaßstab fest

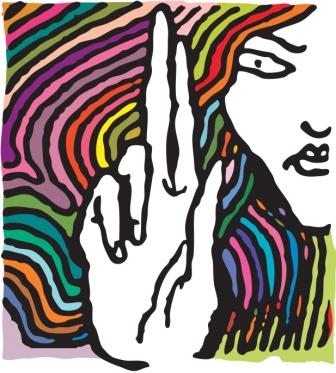
 Polens Disziplinarmaßnahmen gegen Richter untergraben nach Ansicht der EU-Kommission die Unabhängigkeit der Justiz. Richter seien vor politischer Kontrolle nicht geschützt.
Polens Disziplinarmaßnahmen gegen Richter untergraben nach Ansicht der EU-Kommission die Unabhängigkeit der Justiz. Richter seien vor politischer Kontrolle nicht geschützt.