 Die Abschlussveranstaltung war der Verfahrensführung und Entscheidung in Großverfahren in Deutschland – insbesondere aus Sicht des Baurechts und der Umweltverträglichkeit und unter Beteiligung der Öffentlichkeit – gewidmet.
Die Abschlussveranstaltung war der Verfahrensführung und Entscheidung in Großverfahren in Deutschland – insbesondere aus Sicht des Baurechts und der Umweltverträglichkeit und unter Beteiligung der Öffentlichkeit – gewidmet.
So wurde nicht nur eine konzentrierte Verfahrensführung diskutiert, sondern auch ob es sinnvoll ist, Fristen für das Verfahren und Präklusionsbestimmungen für Einwände vorzusehen.
Wenn für die Einwände Präklusion vorgesehen wird, wurde von den Diskutierenden eingeräumt, kann dies zu einer ineffizienten Verfahrensführung führen, da vorerst alle möglichen Einwände – auch noch ohne entsprechende Informationen – vorgebracht werden müssen, auch wenn sie sich später als haltlos darstellen. So wurde auch daran erinnert, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit nach dem europäischen Recht und der Aarhus Konvention zur Einbindung der Öffentlichkeit in einer frühen Phase vorgesehen ist, um das Projekt mithilfe der Öffentlichkeit noch zu gestalten. Des weiteren wurde einheitlich festgehalten, dass es keine Belege gibt, wonach die Abschaffung der Präklusion aufgrund der Aarhus Konvention u einer Verfahrensverzögerung geführt hat.




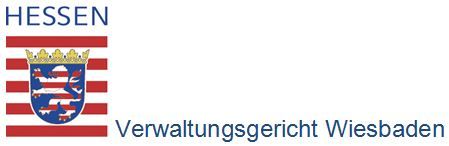 Die „nationale Verfassungslage“ in Deutschland, so der Beschluss der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, gewährleiste „nur die funktionale richterliche Unabhängigkeit, nicht aber eine institutionelle Unabhängigkeit der Gerichte“.
Die „nationale Verfassungslage“ in Deutschland, so der Beschluss der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, gewährleiste „nur die funktionale richterliche Unabhängigkeit, nicht aber eine institutionelle Unabhängigkeit der Gerichte“.