 Durch die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte entfaltet die EU-Luftqualitätsrichtlinie (RL 2008/50/EG) immer mehr Wirkung.
Durch die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte entfaltet die EU-Luftqualitätsrichtlinie (RL 2008/50/EG) immer mehr Wirkung.
Bereits im Jahr 2015 hatte der Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass vor dem Hintergrund der LuftqualitätsRL einem Betroffenen ein Antragsrecht bzw. ein subjektivöffentliches Recht auf Erlassung eines Luftqualitätsplanes zusteht (Zl. Ro 2014/07/0096 vom 28. Mai 2015).
Im Februar dieses Jahres hatte das deutsche Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass Kommunen zur Vermeidung von Stickstoffdioxid-Überschreitungen grundsätzlich Fahrverbote verhängen können. Das Gericht stützte seine Entscheidung ebenfalls unmittelbar auf die RL 2008/50/EG.
In der geplanten Novelle des Immissionsgesetz–Luft wird nunmehr vorgesehen, dass Personen, die von einer Überschreitung der Grenzwerte unmittelbar in ihrer Gesundheit betroffen sind sowie anerkannte Umweltschutzorganisationen das Recht haben, die Erstellung und Überprüfung sogenannter „Luftqualitätspläne“ zu erwirken. Zuständig dafür ist der Landeshauptmann mittels Verordnung.
Grenzwertüberschreitungen auch in Österreich

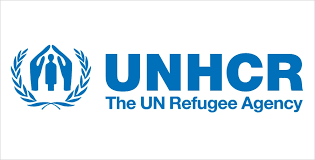 Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hat einen aktuellen Bericht zur Frage des Schutzbedarfs von Asylwerbern aus Afghanistan veröffentlicht.
Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hat einen aktuellen Bericht zur Frage des Schutzbedarfs von Asylwerbern aus Afghanistan veröffentlicht.  Die Verhängung von Schubhaft soll vereinfacht, das „Abtauchen“ abgelehnter Asylwerber erschwert werden.
Die Verhängung von Schubhaft soll vereinfacht, das „Abtauchen“ abgelehnter Asylwerber erschwert werden. Der österreichische Verwaltungsgerichtshof hatte in einem Vorabentscheidungsersuchen (
Der österreichische Verwaltungsgerichtshof hatte in einem Vorabentscheidungsersuchen ( Die beim Europarat angesiedelte „Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz“ (European Commission for the efficiency of justice – CEPEJ) hat sich erstmals umfassend mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Justiz beschäftigt, da die Kommission in dieser Debatte eine wichtige Rolle übernehmen will.
Die beim Europarat angesiedelte „Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz“ (European Commission for the efficiency of justice – CEPEJ) hat sich erstmals umfassend mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Justiz beschäftigt, da die Kommission in dieser Debatte eine wichtige Rolle übernehmen will. Seit den 90er Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Qualität gerichtlicher Entscheidungen nicht adäquat bewertet werden kann, wenn allein die rechtliche Bedeutung der Entscheidungen überprüft wird. Somit steht nicht nur die Gerichtsorganisation in ihrer Gesamtheit auf dem Prüfstand, sondern auch die Gesetzgebung, können doch wenig zufriedenstellende Formulierungen oder ein ungenauer Inhalt der Gesetze oder ein mangelhafter verfahrensrechtlicher Rahmen die Qualität der Gerichtsentscheidungen beeinträchtigen.
Seit den 90er Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Qualität gerichtlicher Entscheidungen nicht adäquat bewertet werden kann, wenn allein die rechtliche Bedeutung der Entscheidungen überprüft wird. Somit steht nicht nur die Gerichtsorganisation in ihrer Gesamtheit auf dem Prüfstand, sondern auch die Gesetzgebung, können doch wenig zufriedenstellende Formulierungen oder ein ungenauer Inhalt der Gesetze oder ein mangelhafter verfahrensrechtlicher Rahmen die Qualität der Gerichtsentscheidungen beeinträchtigen.
 Mehr als 60 Prozent des Plastik- und 13 Prozent des Papiermülls aus der gesamten EU wurden in den vergangenen Jahren nach China exportiert.
Mehr als 60 Prozent des Plastik- und 13 Prozent des Papiermülls aus der gesamten EU wurden in den vergangenen Jahren nach China exportiert.