 Ab Jänner 2020 sollten in Ungarn ein neues Oberstes Verwaltungsgericht und 8 Verwaltungsgerichte erster Instanz ihre Arbeit aufnehmen. Die Auswahl der rund 300 neuen Richterinnen und Richter war bereits abgeschlossen. Letzte Woche beschloss die Regierung zur Überraschung aller Betroffenen, die vom Parlament bereits beschlossene und kundgemachte Justizreform zu kippen.
Ab Jänner 2020 sollten in Ungarn ein neues Oberstes Verwaltungsgericht und 8 Verwaltungsgerichte erster Instanz ihre Arbeit aufnehmen. Die Auswahl der rund 300 neuen Richterinnen und Richter war bereits abgeschlossen. Letzte Woche beschloss die Regierung zur Überraschung aller Betroffenen, die vom Parlament bereits beschlossene und kundgemachte Justizreform zu kippen.
Die von Ungarn beschlossene Einrichtung neuer Verwaltungsgerichte war von EU-Parlament mit Sorge betrachtet worden, da die Unabhängigkeit der neuen Gerichte durch die Möglichkeit politischer Einflussnahme nicht gewährleistet erschien. (Siehe dazu: Umstrittene Justizreform in Ungarn – Österreich als Vorbild genannt)
Neben der politischen Ernennung der Gerichtspräsidenten war ein besonderer Kritikpunkt das Auswahlverfahren für jene neuen Verwaltungsrichter, die nicht bereits zuvor an den Zivilgerichten tägig waren, sondern aus der öffentlichen Verwaltung rekrutiert wurden.


 Bürgerrechts-Organisationen in Österreich und Deutschland halten die sogenannte PNR-Richtlinie der EU für grundrechtswidrig und bereiten Beschwerden bei den Höchstgerichten vor.
Bürgerrechts-Organisationen in Österreich und Deutschland halten die sogenannte PNR-Richtlinie der EU für grundrechtswidrig und bereiten Beschwerden bei den Höchstgerichten vor.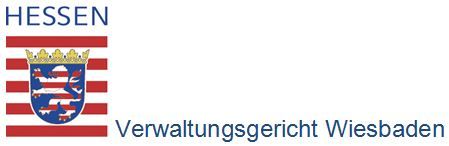 Die „nationale Verfassungslage“ in Deutschland, so der Beschluss der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, gewährleiste „nur die funktionale richterliche Unabhängigkeit, nicht aber eine institutionelle Unabhängigkeit der Gerichte“.
Die „nationale Verfassungslage“ in Deutschland, so der Beschluss der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, gewährleiste „nur die funktionale richterliche Unabhängigkeit, nicht aber eine institutionelle Unabhängigkeit der Gerichte“. Ab dem Jahr 2020 müssen alle neu typisierten und ab 2024 alle neu zugelassenen Autos mit einer Vielzahl an Sicherheitssystemen wie Blackboxen, Tempoassistenten und Notbremssystemen ausgestattet sein. Grundlage für diese Neuregelungen ist die legislative
Ab dem Jahr 2020 müssen alle neu typisierten und ab 2024 alle neu zugelassenen Autos mit einer Vielzahl an Sicherheitssystemen wie Blackboxen, Tempoassistenten und Notbremssystemen ausgestattet sein. Grundlage für diese Neuregelungen ist die legislative  Liste „Jetzt“ will stärkere Unabhängigkeit der Verwaltungsgerichte.
Liste „Jetzt“ will stärkere Unabhängigkeit der Verwaltungsgerichte. Der Dachverband der Verwaltungsrichter (DVVR) hat in einem
Der Dachverband der Verwaltungsrichter (DVVR) hat in einem
 Der beim Europarat angesiedelte
Der beim Europarat angesiedelte