 Als erste Stadt in den USA hat San Francisco den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie durch Behörden verboten. Die Gefahr, dass der Einsatz solcher Technologie die Bürgerrechte verletzen könne, überwiege die vermeintlichen Vorteile bei Weitem, entschied der Stadtrat.
Als erste Stadt in den USA hat San Francisco den Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie durch Behörden verboten. Die Gefahr, dass der Einsatz solcher Technologie die Bürgerrechte verletzen könne, überwiege die vermeintlichen Vorteile bei Weitem, entschied der Stadtrat.
Der Einsatz von Gesichtserkennung drohe ethnische Ungerechtigkeit zu verschärfen und „bedroht unsere Möglichkeit, frei von ständiger Beobachtung durch die Regierung zu leben“, heißt es in dem Stadtratsbeschluss der kalifornischen Metropole am Dienstag (Ortszeit).
Die städtische Polizei und andere städtische Behörden dürfen gemäß der Entscheidung keine Gesichtserkennungstechnologie erwerben, besitzen oder nutzen. „Wir haben eine gute Überwachung, ohne ein Polizeistaat zu sein“, zitierte der „San Francisco Chronicle“ Stadtratsmitglied Aaron Peskin, der das Verbot dem Bericht zufolge eingebracht hatte. Gerade San Francisco als „Tech-Hauptquartier“ habe hier Verantwortung zu übernehmen und müsse neue Technologien daher genau regulieren, so Aaron.
Flughafen und Hafen ausgenommen
Der Stadtrat beschloss mit acht Stimmen und einer Gegenstimme zudem, dass San Franciscos Behörden offenlegen müssen, welche Überwachungstechnologie sie nutzen. Er behält sich ferner die Kompetenz vor, den Einsatz neuer Technologie zum Sammeln und Speichern von Personendaten zu genehmigen.
Das Verbot muss dem Bericht zufolge aber noch eine weitere Abstimmung in diesem Gremium passieren und dann von Bürgermeisterin London Breed unterschrieben werden, bevor es in Kraft tritt. Der Flughafen und der Hafen werden ausgenommen sein, da sie unter Bundeskompetenz fallen.
„Starker Eingriff in die Privatsphäre“

 Bürgerrechts-Organisationen in Österreich und Deutschland halten die sogenannte PNR-Richtlinie der EU für grundrechtswidrig und bereiten Beschwerden bei den Höchstgerichten vor.
Bürgerrechts-Organisationen in Österreich und Deutschland halten die sogenannte PNR-Richtlinie der EU für grundrechtswidrig und bereiten Beschwerden bei den Höchstgerichten vor. Ab dem Jahr 2020 müssen alle neu typisierten und ab 2024 alle neu zugelassenen Autos mit einer Vielzahl an Sicherheitssystemen wie Blackboxen, Tempoassistenten und Notbremssystemen ausgestattet sein. Grundlage für diese Neuregelungen ist die legislative
Ab dem Jahr 2020 müssen alle neu typisierten und ab 2024 alle neu zugelassenen Autos mit einer Vielzahl an Sicherheitssystemen wie Blackboxen, Tempoassistenten und Notbremssystemen ausgestattet sein. Grundlage für diese Neuregelungen ist die legislative 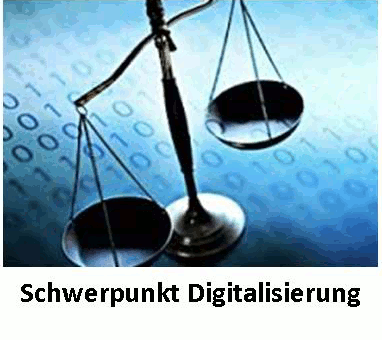 Auf Beschluss des EU-Parlaments sollen mehrere europäische Behörden künftig die von ihnen erfassten biometrischen Daten in einen gemeinsamen Bestand zusammenlegen.
Auf Beschluss des EU-Parlaments sollen mehrere europäische Behörden künftig die von ihnen erfassten biometrischen Daten in einen gemeinsamen Bestand zusammenlegen. Das Verwaltungsgericht Wien hatte ein Straferkenntnis bestätigt, mit welchen der Beschwerdeführer bestraft worden war, weil dieser in Wien ein Ferienapartment über Buchungsplattformen zur Vermietung angeboten hatte, ohne über die erforderliche Gewerbeberechtigung zu verfügen.
Das Verwaltungsgericht Wien hatte ein Straferkenntnis bestätigt, mit welchen der Beschwerdeführer bestraft worden war, weil dieser in Wien ein Ferienapartment über Buchungsplattformen zur Vermietung angeboten hatte, ohne über die erforderliche Gewerbeberechtigung zu verfügen. Nach einer Berechnung der ARGE-Daten, der Österreichischen Gesellschaft für Datenschutz mit Sitz in Wien, sind alle Österreicherinnen und Österreicher bei etwa 400 bis 500 Datenverarbeitern registriert. Persönliche Informationen seien also in Form von Datensätzen von diesen Stellen erfasst und gespeichert worden, sagt der Vorstand der ARGE-Daten, Hans Zeger.
Nach einer Berechnung der ARGE-Daten, der Österreichischen Gesellschaft für Datenschutz mit Sitz in Wien, sind alle Österreicherinnen und Österreicher bei etwa 400 bis 500 Datenverarbeitern registriert. Persönliche Informationen seien also in Form von Datensätzen von diesen Stellen erfasst und gespeichert worden, sagt der Vorstand der ARGE-Daten, Hans Zeger. Das Vorreiterland in Sachen Digitalisierung setzt bereits in 13 staatlichen Verwaltungsbereichen auf Algorithmen statt Menschen. Bringt KI in der Justiz mehr Fairness?
Das Vorreiterland in Sachen Digitalisierung setzt bereits in 13 staatlichen Verwaltungsbereichen auf Algorithmen statt Menschen. Bringt KI in der Justiz mehr Fairness?
 Es ist eine Diskussion, die gerade in den vergangenen Jahren neue Nahrung gewonnen hat. Soll der Staat die Überwachungsmaßnahmen ausdehnen, um für mehr Sicherheit zu sorgen? Oder ist es wichtiger, die Freiheit der Bürger zu erhalten?
Es ist eine Diskussion, die gerade in den vergangenen Jahren neue Nahrung gewonnen hat. Soll der Staat die Überwachungsmaßnahmen ausdehnen, um für mehr Sicherheit zu sorgen? Oder ist es wichtiger, die Freiheit der Bürger zu erhalten?