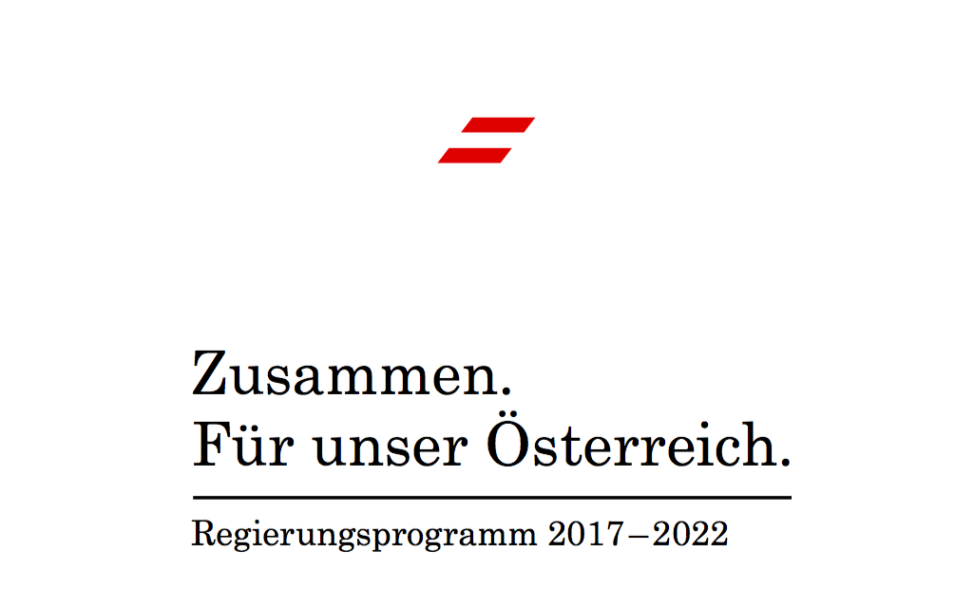 Proteste angekündigt
Proteste angekündigt
Die Richtervereinigung stellt sich erneut gegen Sparpläne der Bundesregierung. Laut ersten Informationen zum Justizbudget sei die Personalsituation zumindest für 2019 nach wie vor ungeklärt, kritisierte Präsidentin Sabine Matejka im Gespräch mit der APA. Sie sandte am Dienstag ein Terminansuchen an Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Protestmaßnahmen der Richter seien nicht ausgeschlossen. Wenn die Einsparungen wie befürchtet kämen, „werden wir uns sicher massiv wehren“. Wie genau, ließ Matejka noch offen.
Gerichtspraxis soll wieder verkürzt werden
Nicht nur könnte nur jede zweite oder dritte Stelle nachbesetzt werden, warnte sie, auch die Gerichtspraxis soll wieder von sieben auf fünf Monate zusammengekürzt werden, habe man erfahren. Erst 2016 war diese von fünf auf sieben Monate erhöht worden, nachdem die Ausbildung der Juristen im Zuge des Sparpakets 2011 stark eingeschränkt worden war.
Für Matejka wäre eine Verkürzung „unsinnig“; im Sinne der Ausbildung, aber auch, weil die Praktikanten aufgrund der angespannten Personalsituation fast schon als Systemerhalter fungierten. Deutliche Kürzungen seien auch im Bereich der Fortbildung und bei der IT (Stichwort: digitaler Akt) avisiert worden.
Massive Probleme bei nichtrichterlichem Personal
Den Rest des Beitrags lesen »


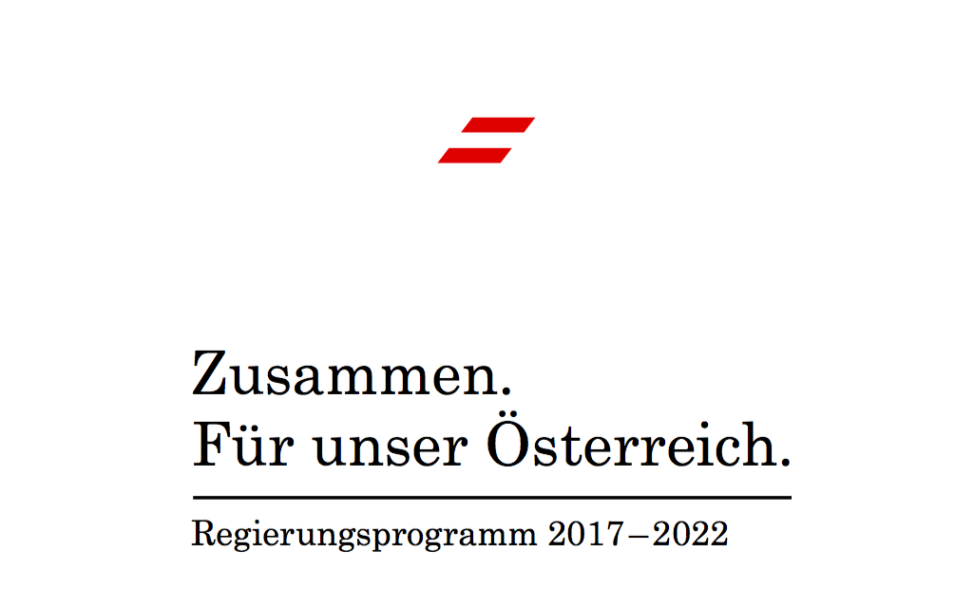 Proteste angekündigt
Proteste angekündigt Verschiebung aus Kostengründen
Verschiebung aus Kostengründen 


 Was Daten über uns verraten
Was Daten über uns verraten  „Big Data“ birgt Gefahren für rechtsstaatliche Prinzipien
„Big Data“ birgt Gefahren für rechtsstaatliche Prinzipien 