 Im Jahr 2018 standen die digitale Autobahnvignette, das Unfallmeldesystem E-Call, die digitale Identität, digitale Behördenwege, das zentralisierte Datenregister, das Transparenzregister (gegen Geldwäsche), die biometrische Einreisekontrolle und anderes mehr auf der Agenda der Regierung. (Siehe dazu: Das digitale Jahr 2018)
Im Jahr 2018 standen die digitale Autobahnvignette, das Unfallmeldesystem E-Call, die digitale Identität, digitale Behördenwege, das zentralisierte Datenregister, das Transparenzregister (gegen Geldwäsche), die biometrische Einreisekontrolle und anderes mehr auf der Agenda der Regierung. (Siehe dazu: Das digitale Jahr 2018)
(Ergänzungen zu „Vermummungsverbot, Uploadfilter: Was 2019 netzpolitisch auf Österreich zukommt “ von Muzayen Al-Youssef – derstandard.at)
Auch im Jahr 2019 wird die Digitalisierung vieler Lebensbereiche weiter Gestalt annehmen. Hier ein Überblick über bevorstehende Maßnahmen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Ab Jänner: Teilautonomes Fahren
Mit einer Novelle zur „Automatisiertes Fahren Verordnung“ ( AutomatFahrV) wird es in Österreich künftig erlaubt sein, Einparkhilfen zu verwenden, für die der Lenker nicht im Fahrzeug sitzen muss.
Die Einparkhilfe muss in der Lage sein, alle übertragenen Fahraufgaben beim Ein- und Ausparken automatisch zu bewältigen, wird im geplanten Gesetzestext betont. „Solange das System aktiviert ist, ist der Lenker von den Verpflichtungen, den Lenkerplatz einzunehmen und die Lenkvorrichtung während des Fahrens mit mindestens einer Hand festzuhalten, enthoben.“ Der Lenker muss sich aber „in Sichtweite zum Fahrzeug befinden“ und im Notfall eingreifen können. Erlaubt ist diese Art der Einparkhilfe nur für Pkws (Klasse M1).
Ab Jänner: Wertkarten-SIMs müssen registriert werden
Den Rest des Beitrags lesen »
 In der vieldiskutierten Causa rund um die Nachbesetzung des Präsidentenpostens am Landesverwaltungsgericht gibt es eine überraschende Wendung: Die Büroleiterin des Landeshauptmannes zieht ihre Bewerbung zurück.
In der vieldiskutierten Causa rund um die Nachbesetzung des Präsidentenpostens am Landesverwaltungsgericht gibt es eine überraschende Wendung: Die Büroleiterin des Landeshauptmannes zieht ihre Bewerbung zurück.
 Ab Jänner: Elektronische Beweismittel
Ab Jänner: Elektronische Beweismittel 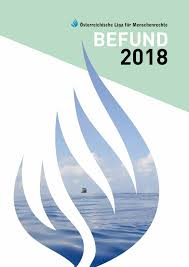 von Siegfried Königshofer
von Siegfried Königshofer Mit Erkenntnis vom 25.9.2018, G 414/2017, hat der VfGH einen gegen § 38a Abs. 6 SPG gerichteten Gesetzesprüfungsantrag abgewiesen.
Mit Erkenntnis vom 25.9.2018, G 414/2017, hat der VfGH einen gegen § 38a Abs. 6 SPG gerichteten Gesetzesprüfungsantrag abgewiesen. 2018 war ein hartes, schwieriges Jahr für die österreichische Justiz.
2018 war ein hartes, schwieriges Jahr für die österreichische Justiz.