 Dem Vortragenden Dr. Udo Schneider, Präsident des Verwaltungsgerichts Meiningen, zufolge ist es verkürzt, die Beurteilung der richterlichen Arbeit nur anhand des Ergebnisses, nämlich der Entscheidung selbst, vorzunehmen.
Dem Vortragenden Dr. Udo Schneider, Präsident des Verwaltungsgerichts Meiningen, zufolge ist es verkürzt, die Beurteilung der richterlichen Arbeit nur anhand des Ergebnisses, nämlich der Entscheidung selbst, vorzunehmen.
Vielmehr ist der Prozess zu beleuchten, wie die einzelne Person aufgrund der fundierten Ausbildung, Erfahrung und Sozialisation zum Richter wird und das unabhängige und unbefangene, fachlich fundierte Urteil in einem von ihr zu leitenden fairen Verfahren „findet“ bzw. erkennt“. Dabei spielt nicht nur die fachliche, sondern auch die soziale Kompetenz eine wesentliche Rolle.
Wie kann ein Richter ein gutes Erkenntnis „finden“, nach welchen Maßstäben erfolgt die Beurteilung „gut“? Was sind die Kriterien für eine gute Entscheidungsfindung und gute Prozesskultur? Wie unterliegt die Beurteilung dem gesellschaftlichen Wandel?
Neben den erlernbaren Methoden und dem Handwerkszeug ist vor allem die Haltung zur guten richterlichen Tätigkeit gefragt. Die Judikative kann ihre Funktion nur erfüllen, wenn die Richter nicht nur den juristischen Anforderungen an ihre Tätigkeit gerecht werden, sondern auch ihr Amt mit uneingeschränkter Integrität ausüben. Die Beschäftigung mit ethischen Verhaltensstandards ist für die Justiz daher ein unverzichtbarer Bestandteil.



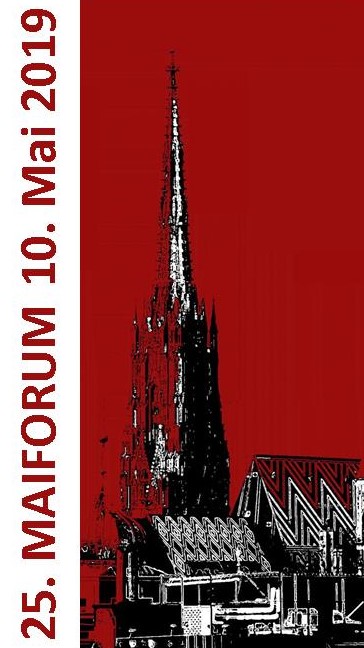 In Frankreich gibt es 42 Verwaltungsgerichte, acht Berufungsgerichte in Verwaltungssachen sowie ein Asylgericht mit insgesamt rund 1400 Richtern, von denen aber nur ca. 1150 aktiv sind (zum Vergleich: die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit verfügt über etwas mehr als 8300 Richter). Die übrigen sind befristet in der Verwaltung (d.h. in der exekutiven Staatsgewalt!) tätig.
In Frankreich gibt es 42 Verwaltungsgerichte, acht Berufungsgerichte in Verwaltungssachen sowie ein Asylgericht mit insgesamt rund 1400 Richtern, von denen aber nur ca. 1150 aktiv sind (zum Vergleich: die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit verfügt über etwas mehr als 8300 Richter). Die übrigen sind befristet in der Verwaltung (d.h. in der exekutiven Staatsgewalt!) tätig.
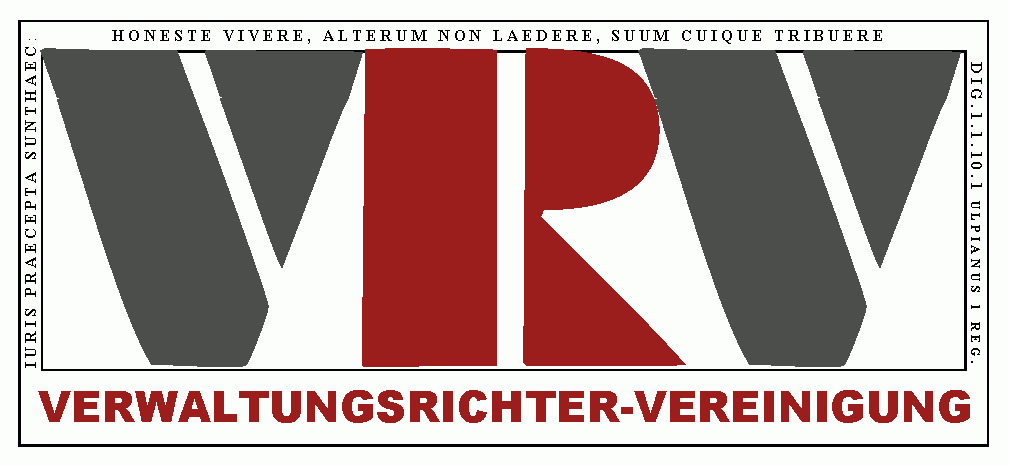 Am Vorabend des 25. Maiforums fand die Vollversammlung der Verwaltungsrichter-Vereinigung (VRV) dieses Jahr am Bundesfinanzgericht in Wien statt.
Am Vorabend des 25. Maiforums fand die Vollversammlung der Verwaltungsrichter-Vereinigung (VRV) dieses Jahr am Bundesfinanzgericht in Wien statt. Zur Wahrung der Unabhängigkeit der an Verwaltungsgerichten tätigen Richterinnen und Richtern kommt den diesbezüglichen Auswahl- und Ausbildungssystemen eine besondere Bedeutung zu. Anlass genug für die Standesvertretungen der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter einen Staaten übergreifenden Vergleich anzustellen und das 25. Maiforum als internationale Konferenz mit Vortragenden aus vier europäischen Ländern auszurichten.
Zur Wahrung der Unabhängigkeit der an Verwaltungsgerichten tätigen Richterinnen und Richtern kommt den diesbezüglichen Auswahl- und Ausbildungssystemen eine besondere Bedeutung zu. Anlass genug für die Standesvertretungen der Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter einen Staaten übergreifenden Vergleich anzustellen und das 25. Maiforum als internationale Konferenz mit Vortragenden aus vier europäischen Ländern auszurichten.  Der Dachverband der Verwaltungsrichter (DVVR) hat in einem
Der Dachverband der Verwaltungsrichter (DVVR) hat in einem