 Einige Staaten in Mittel- und Südosteuropa nutzen die Corona-Krise, um rechtsstaatliche Grundsätze und Institutionen auszuhebeln. Allen voran Ungarn. Die EU-Kommission will zu diesen Vorgängen vorläufig keine Stellungnahme abgeben.
Einige Staaten in Mittel- und Südosteuropa nutzen die Corona-Krise, um rechtsstaatliche Grundsätze und Institutionen auszuhebeln. Allen voran Ungarn. Die EU-Kommission will zu diesen Vorgängen vorläufig keine Stellungnahme abgeben.
Geltung der EMRK wird ausgesetzt
In Zeiten von Epidemien müssen Gesellschaften massive Einschränkungen ihres öffentlichen Lebens hinnehmen. So auch in der aktuellen Corona-Krise. Es geht, für alle nachvollziehbar, bei befristeten Kontaktverboten, Ausgangs- und Reisesperren darum, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Nun jedoch nutzen einige mittel- und südosteuropäische Länder die Corona-Krise, um den Rechtsstaat auszuhebeln, ohne dass dies bessere Erfolgsaussichten bei der Bekämpfung der Epidemie hätte.
So etwa will die neue slowakische Regierung ein Gesetz verabschieden, das staatlichen Institutionen den Zugriff auf Daten von Telekommunikationsbetreibern erlaubt. Durch Handy-Tracking soll sichergestellt werden, dass Personen in Quarantäne isoliert bleiben.

 Die EU-Kommission hält es aus datenschutzrechtlicher Sicht für möglich,
Die EU-Kommission hält es aus datenschutzrechtlicher Sicht für möglich, 
 Der Nationalrat hat am Sonntag vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, das sog. COVID-19-Maßnahmengesetz, beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, die gesetzlichen Grundlagen für die von der Bundesregierung bereits angekündigten Maßnahmen zu schaffen.
Der Nationalrat hat am Sonntag vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, das sog. COVID-19-Maßnahmengesetz, beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, die gesetzlichen Grundlagen für die von der Bundesregierung bereits angekündigten Maßnahmen zu schaffen.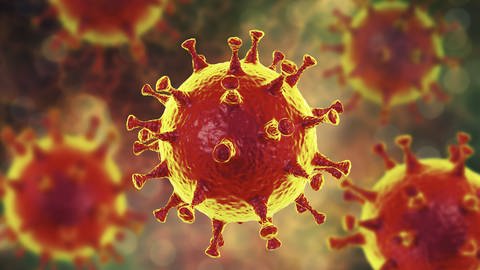
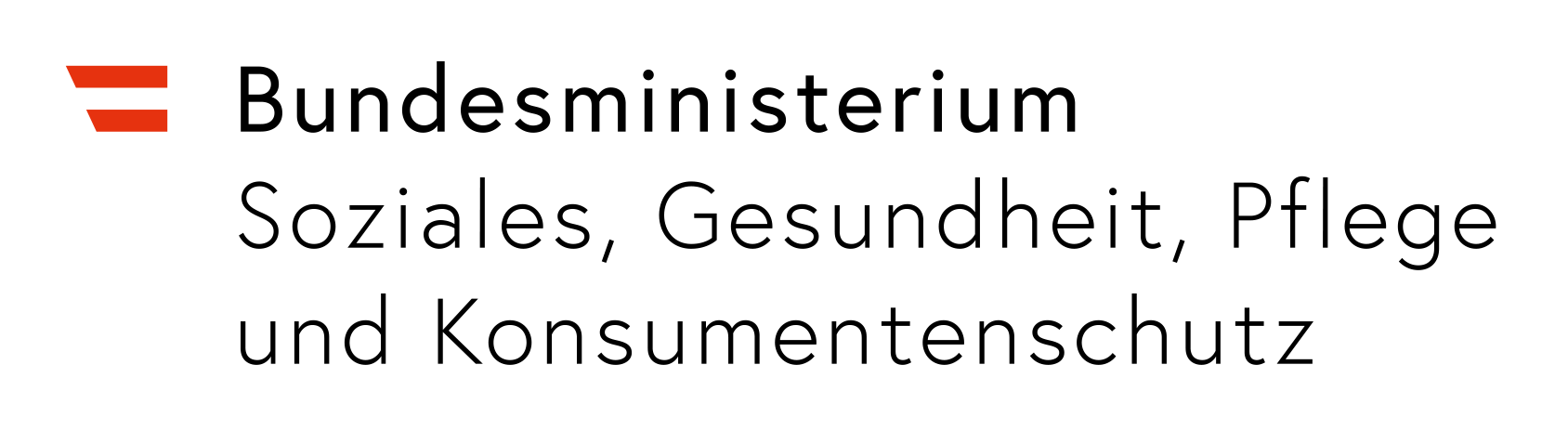
 Die EU-Kommission plant, Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen vorläufig zu verbieten, um Regulierungen entwickeln zu können.
Die EU-Kommission plant, Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen vorläufig zu verbieten, um Regulierungen entwickeln zu können.  Menschenrechtsexperte Manfred Nowak sieht die türkis-grünen Vorhaben mit der Schubhaft bereits erfüllt.
Menschenrechtsexperte Manfred Nowak sieht die türkis-grünen Vorhaben mit der Schubhaft bereits erfüllt.  „Die verdeckte Erfassung und Identifizierung von Lenkern, die Verarbeitung von Daten aus Section-Control-Anlagen durch Sicherheitsbehörden, die geheime Überwachung verschlüsselter Daten und die Ermächtigung zur Installation eines Programms zur Überwachung von Bürgern sind allesamt rechtswidrig“. Das erklärte Christoph Grabenwarter, Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), am Mittwoch.
„Die verdeckte Erfassung und Identifizierung von Lenkern, die Verarbeitung von Daten aus Section-Control-Anlagen durch Sicherheitsbehörden, die geheime Überwachung verschlüsselter Daten und die Ermächtigung zur Installation eines Programms zur Überwachung von Bürgern sind allesamt rechtswidrig“. Das erklärte Christoph Grabenwarter, Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), am Mittwoch. Mit dem vom Nationalrat im April 2018 beschlossenen
Mit dem vom Nationalrat im April 2018 beschlossenen