 Der langjährige Präsident der österreichischen Richtervereinigung, Dr. Werner Zinkl, schilderte in seinem
Der langjährige Präsident der österreichischen Richtervereinigung, Dr. Werner Zinkl, schilderte in seinem

Vortrag die Beweggründe, die im Jahr 2007 zur Beschlussfassung der „Welser Erklärung“ geführt hatten.
Es sei darum gegangen, professionelle Verhaltensrichtlinien für die richterliche Tätigkeit zu formulieren. Denn die Erfahrungen zeigten, dass es für Rechtsschutzsuchende eine zentrale Frage sei, wie sie vom Gericht behandelt werden. Das sei in der Rückschau oft wichtiger als der Rechtsstreit selbst. Das betreffe insbesondere die Erreichbarkeit des Richters für Anliegen der Betroffenen oder den Umgang des Richters mit Parteien in der Verhandlung selbst.




 Insgesamt drei Entwürfe hat der Verfassungsdienst (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) derzeit zur Begutachtung ausgesendet, welche Änderungen des AVG, des VStG und des VwGVG betreffen sowie die Erlassung eines Bundesgesetzes über die Europäische Ermittlungsanordnung in Verwaltungsstrafsachen.
Insgesamt drei Entwürfe hat der Verfassungsdienst (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) derzeit zur Begutachtung ausgesendet, welche Änderungen des AVG, des VStG und des VwGVG betreffen sowie die Erlassung eines Bundesgesetzes über die Europäische Ermittlungsanordnung in Verwaltungsstrafsachen.
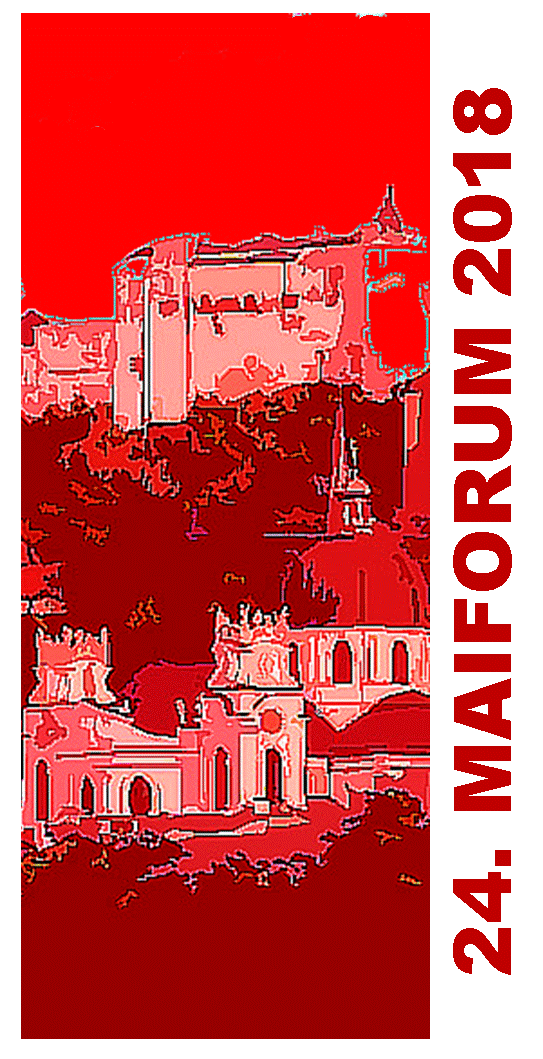 Richterliche Integrität auf dem Prüfstand
Richterliche Integrität auf dem Prüfstand Standesvertreter der Richter und Staatsanwälte richten einen Appell an die Regierung: Keine personellen und finanziellen Einsparungen an den Gerichten.
Standesvertreter der Richter und Staatsanwälte richten einen Appell an die Regierung: Keine personellen und finanziellen Einsparungen an den Gerichten.