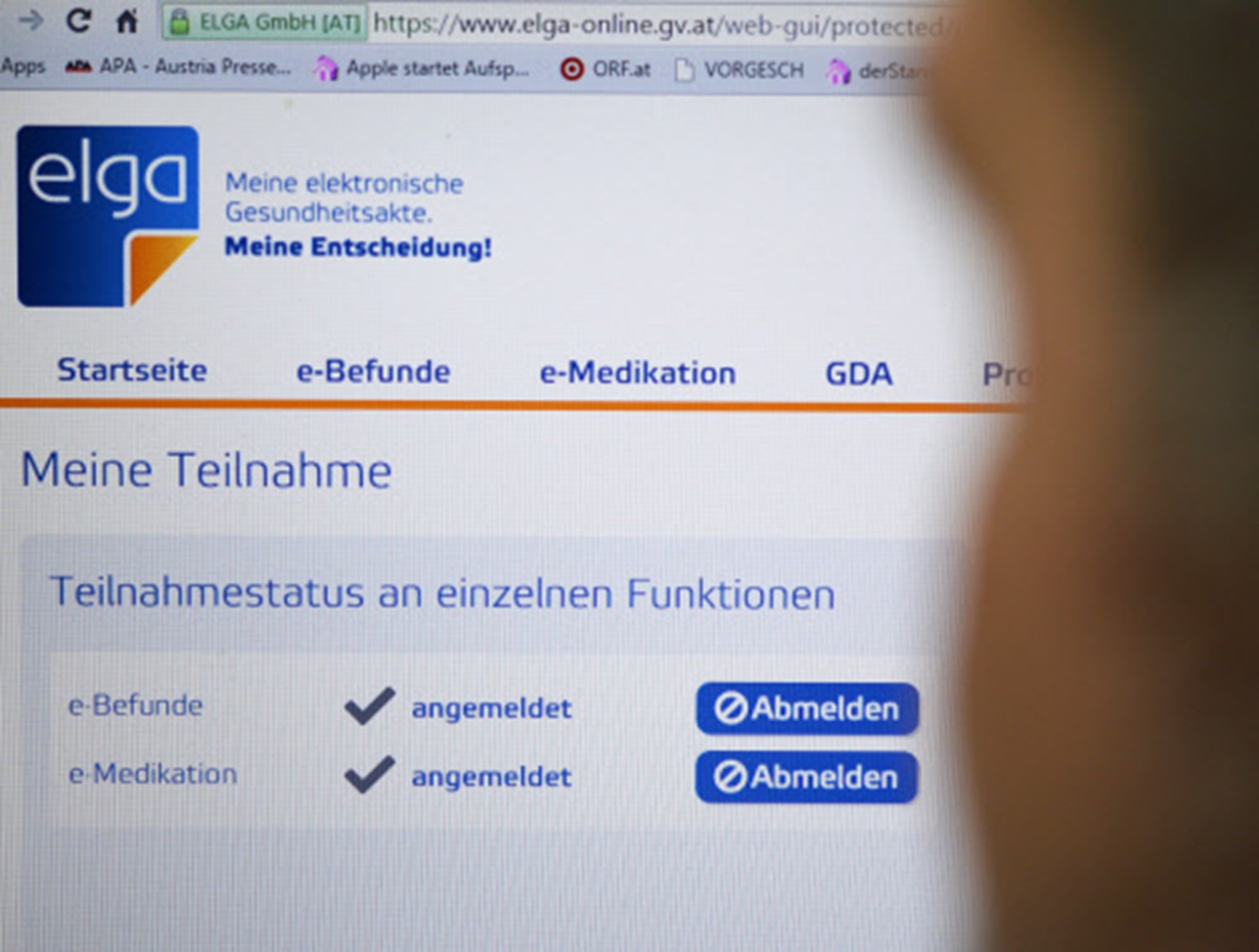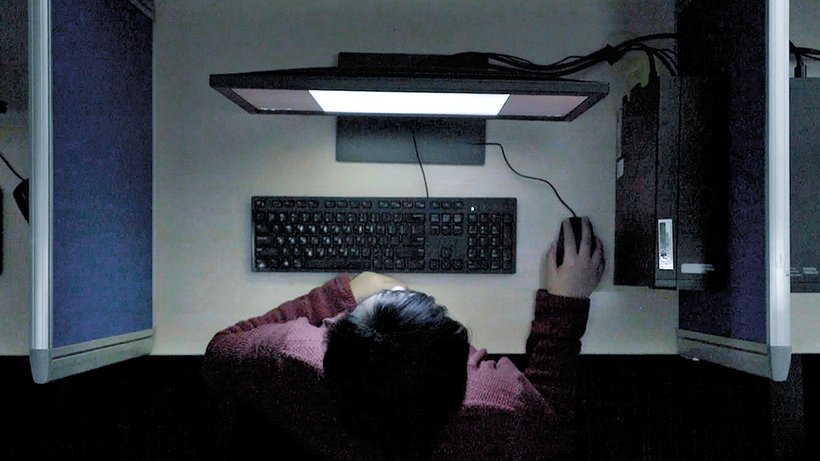
In der Netflix-Serie „Black Mirror“ ist das Internet der Spiegel der realen Welt. Jedoch werden nur die negativen, die bösen Seiten der Realität gespiegelt. Wer aber entscheidet über „Gut“ und „Böse“ im Internet, über legal und illegal ?
Konzerninterne Guidelines ersetzten rechtsstaatliche Regeln
Der deutsch-brasilianische Dokumentarfilm „THE CLEANERS“ enthüllt eine gigantische Schattenindustrie digitaler Zensur in Manila, dem weltweit größten Outsourcing-Standort für „Content“- Moderation. Dort löschen zehntausende Menschen in zehn Stunden Schichten im Auftrag der großen Silicon Valley-Konzerne belastende Fotos und Videos von Facebook, YouTube, Twitter&Co. Komplexe Entscheidungen über Zensur oder Sichtbarkeit von Inhalten werden so an die „Content“- Moderatoren outgesourct. Die Kriterien und Vorgaben, nach denen sie agieren, ist eines der am besten geschützten Geheimnisse des Silicon Valleys. So werden in der virtuellen Welt des Internets die demokratischen und rechtsstaatlichen Regeln der realen Welt durch geheime Guidelines der Internetkonzerne ersetzt.
„Geoblocking“ und Account-Sperre

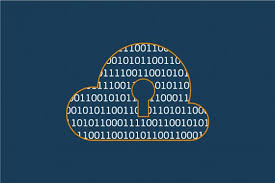 Ab heute gilt die EU-Datenschutz Grundverordnung. Hinter dem Wortungetüm steht ein Gesetz, das EU-Bürgern das Recht auf die eigenen Daten wiedergeben will.
Ab heute gilt die EU-Datenschutz Grundverordnung. Hinter dem Wortungetüm steht ein Gesetz, das EU-Bürgern das Recht auf die eigenen Daten wiedergeben will.  Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat die Aufnahmen sogenannter Dashcams als Beweismittel vor Gericht zur Klärung von Verkehrsunfällen für zulässig erklärt.
Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat die Aufnahmen sogenannter Dashcams als Beweismittel vor Gericht zur Klärung von Verkehrsunfällen für zulässig erklärt. Die Stärkung des Grenzschutzes und der inneren Sicherheit ist eine der zentralen politischen Fragen der EU. Dabei verfolgt die EU – neben der weiteren Stärkung der Europäischen Grenz- und Küstenwache oder der Verlagerung von Kontrollen in die europäische Nachbarschaft – einen dritten, weniger bekannte Ansatz: Den Aufbau sogenannter intelligenter Grenzen und Infrastrukturen für den grenzüberschreitenden Datenaustausch.
Die Stärkung des Grenzschutzes und der inneren Sicherheit ist eine der zentralen politischen Fragen der EU. Dabei verfolgt die EU – neben der weiteren Stärkung der Europäischen Grenz- und Küstenwache oder der Verlagerung von Kontrollen in die europäische Nachbarschaft – einen dritten, weniger bekannte Ansatz: Den Aufbau sogenannter intelligenter Grenzen und Infrastrukturen für den grenzüberschreitenden Datenaustausch.