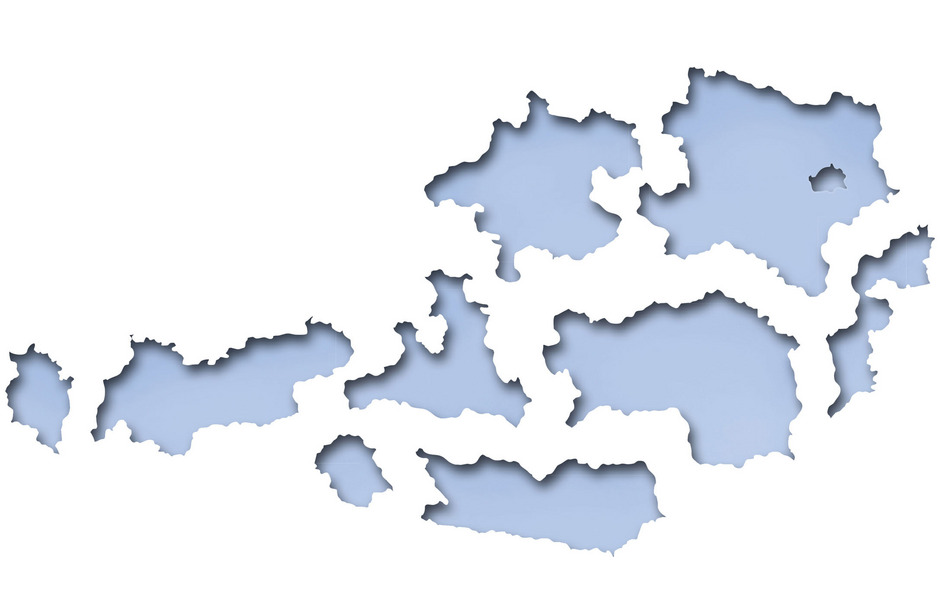 Auch die neue Regierung verspricht eine Bundesstaatsreform. Doch zwischen der Absicht und dem Tun liegen die Hürden des föderativen Anspruchs und der herrschenden Realverfassung. Ein Abriss von Ferdinand Karlhofer.
Auch die neue Regierung verspricht eine Bundesstaatsreform. Doch zwischen der Absicht und dem Tun liegen die Hürden des föderativen Anspruchs und der herrschenden Realverfassung. Ein Abriss von Ferdinand Karlhofer.
„Echte“ Föderationen mit gleichem Rechtsstatus für alle Landesteile gibt es in Europa nur vier: die Schweiz, Österreich, Deutschland und Belgien. Im Fall Österreich gibt es verschiedentlich allerdings Zweifel, ob das Land tatsächlich als Föderation einzustufen ist. In der Tat, beim Durchblättern der Verfassung springt ins Auge, dass die Kompetenzfelder des Bundes detailreich aufgelistet sind, während die Rechte der Bundesländer auf nicht näher definierte Residualkompetenzen beschränkt sind. Und eklatant bescheiden ist der Kompetenzrahmen des Bundesrats. Als Parlament der Bundesländer ist ihm eigentlich die Aufgabe zugedacht, Kontrollinstanz und Gegengewicht zum Nationalrat zu sein. Wenn der Einfluss sich aber darin erschöpft, da und dort ein aufschiebendes Veto einzulegen, das dann von der ersten Kammer ohne lange Prozedur mittels Beharrungsbeschluss zurückgewiesen wird, kann von Kontrolle nicht wirklich die Rede sein.
Verfassung und Verfassungswirklichkeit
So weit die Nominalverfassung mit all ihren mittlerweile hundert Jahre zurückreichenden Baufehlern. Wie aber sieht die Realverfassung aus? Eine Schlüsselfunktion kommt dabei der Institution Landeshauptmann (LH) zu. Dem Landeshauptmann, und nur ihm, untersteht die gesamte Landesverwaltung. Nur der Landeshauptmann mit seiner Verwaltung ist Vollzugsorgan für die so genannte mittelbare Bundesverwaltung, die dem Verfassungstext zufolge der Bundespolitik zuarbeiten soll, in der Praxis aber zentralstaatliche Zielvorstellungen nicht selten konterkariert, statt sie zu stützen. Nicht außer Betracht gelassen werden kann in diesem Zusammenhang die Landeshauptleutekonferenz.
Erwähnt in keinem Verfassungstext, ist die Landeshauptleutekonferenz eine Art Club von Vetospielern, die sich immer dann mit markigem Ton zu Wort melden, wenn sie Länderinteressen — faktisch oder auch vermeintlich — von bundespolitischen Vorhaben beeinträchtigt sehen. Unscharfe Abgrenzung der Kompetenzfelder, Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung, immer wieder auftretende Blockadesituationen — alles das macht das föderative Gefüge behäbig und nicht zuletzt auch teuer.
Seit Jahrzehnten ist allen Akteuren in Verantwortung bewusst, dass der österreichische Bundesstaat eine umfassende Reform braucht. Den Startschuss bildete 1992 das so genannte Perchtoldsdorfer Abkommen.
Groß waren anfänglich die Erwartungen, bald schon aber erlahmte der Reformeifer. Es folgten weitere Initiativen, allesamt ohne Erfolg. Den bis dato größten Anlauf unternahm 2003 die — damals — schwarz-blaue Koalition mit der Einberufung eines „Österreich-Konvents“.
Sein Arbeitsauftrag: Ausarbeitung einer grundlegend neuen Verfassung, mit der insbesondere die Schwächen der föderalen Architektur beseitigt werden sollten. Viele Akteure aus Politik, Institutionen und Zivilgesellschaft waren beteiligt. Zu Jahresbeginn 2005 lag dann das Ergebnis vor. Im Parlament wurde der Entwurf nach kurzer Debatte an den zuständigen Ausschuss zur Bearbeitung weitergeleitet.
Dreizehn Jahre sind inzwischen verstrichen, realisiert worden ist von diesem „Meilenstein zu einer neuen Verfassung“, wie man ihn nicht ohne Stolz betitelt hatte, mit Ausnahme einiger weniger Punkte bis heute nichts. So spektakulär der Konvent seinerzeit gestartet wurde, so sang- und klanglos ist seine Arbeit in Vergessenheit geraten.
Notorisch reformresistent?
Ist der festgefahrene österreichische Föderalismus mit all seinen Unzulänglichkeiten „auf ewig“ unreformierbar? Er müsste es nicht sein. Die Frage ist nur, wo und vor allem wie anzusetzen ist. Ein Blick über den Tellerrand könnte da schon weiterhelfen. Und welches Land, wenn nicht die Schweiz, könnte in Sachen Föderalismus Impulse geben, zumal dort eine umfangreiche Verfassungsreform äußerst erfolgreich über die Bühne ging?
In einem ersten Schritt wurde in der Schweiz festgelegt, wer aller von der Verfassungsänderung betroffen sein würde (es waren viele). Im Weiteren wurden alle relevanten Akteure mit Mitspracherecht in den Prozess eingebunden. Und um möglichst allen Ansprüchen gerecht zu werden, wurde bewusst eine lange Verfahrensdauer in Kauf genommen — mit Start 1991 und Abschluss 2008. Sowohl der Parteienkonsens als auch das Ergebnis des abschließend abzuhaltenden Referendums zeitigten dann ein klares Ergebnis: Das Reformvorhaben wurde sowohl vom Parlament als auch von der Bevölkerung mit großer Mehrheit akzeptiert. Was also ist in Österreich bislang schiefgelaufen? Einige unverzichtbare Punkte wurden und werden offenkundig sträflich vernachlässigt: Wer am Föderalismus rührt, rührt an einem der so genannten Baugesetze unserer Verfassung. Und wer an dieser rührt, braucht eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Davon ist die aktuelle Regierung mit ihren 113 von 183 Mandaten weit entfernt. Sie müsste sich also der Kooperation mindestens der NEOS versichern, um — mit gerade mal einem Mandat Überhang — die nötige Mehrheit zu erreichen. Mehr noch, bei Föderalismusfragen hat sogar der ansonsten zahnlose Bundesrat ein absolutes Vetorecht. Und selbst wenn diese Hürde genommen ist, ist das Ziel immer noch nicht erreicht. Die Änderungen müssen zusätzlich in einer Volksabstimmung bestätigt werden.
Jede Regierung, die den Weg einer Bundesstaatsreform erfolgreich hinter sich bringen möchte, braucht also nicht nur Reformideen. Sie braucht eine gut durchdachte, auf breiten Konsens gestützte Strategie. Es wäre nachgerade naiv zu glauben, man könne mit einfacher parlamentarischer Mehrheit auch nur in Ansätzen den großen Wurf angehen.
Über viele Jahrzehnte war die österreichische Bundesverfassung Spielball zweier Großparteien, die, gestützt auf ihre satte Zweidrittelmehrheit, Verfassungsgesetze beschlossen, die mangels Inkorporationsgebot nicht einmal in den Verfassungstext aufgenommen werden mussten. Damit hat Österreich sich den Ruf eingehandelt, sich die flexibelste und am wenigsten transparente Verfassung der Welt zu leisten.
Die Zeit der parlamentarischen Zweidrittelmehrheiten ist aber ein für alle Mal vorbei, es braucht neue Konzepte und Allianzen für die Realisierung politischer Vorhaben.
Auch die Länder sind in der Pflicht
Der neue Bundeskanzler hat sich im Vorfeld der Nationalratswahl volles Durchgriffsrecht in seiner Partei ausbedungen und ist hier auch bei den mächtigen Landesorganisationen kaum auf Widerstand gestoßen. Das erstaunt insofern, als die Koalition aus Volkspartei und Freiheitlichen erklärtermaßen die Kompetenzen der Länder beschränken will.
Zwar gibt es erstmals seit 1994 wieder einen für Föderalismus zuständigen Minister, doch hat gerade dieser den Ruf, mehr Zentralismus anzustreben. Für den Gesamtstaat muss eine solche Haltung nicht zwingend ein Nachteil sein.
Aber egal in welche Richtung die Verfassungsänderungen gehen sollen — ohne Aufbruchsstimmung und breite Einbindung einer Vielzahl von Akteuren in Bund, Ländern, Parteien und Verbänden ist das Projekt vorab schon zum Scheitern verurteilt.
Außerdem findet sich im fast 200 Seiten starken Regierungsprogramm gerade mal eine (!) Seite zum Thema „Moderner Bundesstaat“, noch dazu voll mit schwammigen Überlegungen und Zielvorgaben, die ohnedies außer Streit stehen sollten (etwa der Zusammenhang Jugendschutz und Tabakkonsum). So wie schon andere vor ihr wird auch die nun im Amt befindliche Regierung ihre Ansage einer großen Bundesstaatsreform schwerlich realisieren können.
Wenn das Scheitern also wieder einmal nachgerade vorprogrammiert ist, könnte einmal überlegt werden, ob die Initiative statt vom Bund nicht besser von den Ländern ausgehen sollte. Die „Westachse“ mit Tirol in federführender Rolle könnte sich hier konstruktiv einbringen.
